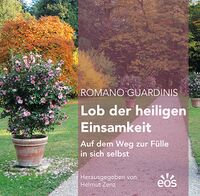Aktuell verzeichnet die Sekundärbibliographie für das Jahr 2025 bereits 124+18=142 Titel (Stand: 2. Dezember 2025):
Biographie
Tagungsband Trumau/Heiligenkreuz 2024
- [2025-001] Der Mensch - "ein Entwurf auf etwa Ungeheures hin". Romano Guardinis Blick auf Christliche Anthropologie, Freiburg/Basel/Wien 2025 [Sammelband] - Leseprobe: https://media.herder.de/leseprobe/978-3-451-02511-2/index.html
- [2025-002] Michael Wladika: Vorwort zur neuen Reihe "Guardini-Studien", S. 5-8 [Artikel] - https://media.herder.de/leseprobe/978-3-451-02511-2/index.html
- [2025-003] Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: Einleitung, S. 9-16 [Artikel] - https://media.herder.de/leseprobe/978-3-451-02511-2/index.html
- [2025-004] Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: „Angerufen von dem, was noch nicht ist.“ Der Mensch im Blick Romano Guardinis, S. 17-30 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-005] Albrecht Voigt: Die Unverfügbarkeit des Menschen im Kontext des Schwangerschaftsabbruchs. Anthropologische Orientierungen mit Romano Guardini, S. 31-42 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-006] Michael Wladika: Illustrativ leben, exemplarisch leben, inkarnatorisch leben. Guardinis Sokrates-Interpretation, S. 43-58 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-007] Domenico Burzo: "In der Höhle des Herzens." Die Schichten der menschlichen Natur in der Anthropologie Romano Guardinis und Pavel Florenskijs, S. 59-94 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-008] Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: Ende der Neuzeit? Zum Radius der Kulturkritik Guardini, S. 95-114 [Artikel] - [noch nicht online], siehe aber: https://www.youtube.com/watch?v=W_EHgAd-MgU
- [2025-009] Harald Seubert: "Größe und Verhängnis menschlicher Schöpferkraft. Die Technik- und Kulturkritik Guardini, mit Seitenblicken auf Heidegger, S. 115-146 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-010] Philemon Dollinger: Peregrinantibus et iter agentibus. Das Wort als Begleiter des Menschen [Artikel] - [noch nicht online], siehe aber: https://www.youtube.com/watch?v=6ES3MiqKXHc
- [2025-011] Bernhard Dolna: Die Gesinnung Gottes und das theologische Denken, S. 173-190 [Artikel] - [noch nicht online], siehe aber: https://www.youtube.com/watch?v=qCjbtGOWc-g (Vortragstitel: Ein Rückblick vom Ende her. Romano Guardinis „Theologische Briefe an einen Freund“)
Biographie/Zeitgeschichte/Zeitgenossen
- [2025-012] Nora Bossong/Jona Krützfeld/Martin Schult: Eine Rückbesinnung auf die Tiefe der Worte. 75 Jahre Friedenspreis des deutschen Buchhandels: Ein Gespräch mit der Schriftstellerin Nora Bossong über Romano Guardini, den Theologen und Friedenspreisträger von 1952, in: Frankfurter Allgemeine, 2025, 30. August [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-013] Walter Kasper: Der Wahrheit auf der Spur: Mein Weg in Kirche und Theologie, 2025 [Monographie]/[Memoiren] - https://books.google.de/books?id=yOJYEQAAQBAJ; zu Romano Guardini S. 26, 31, 34, 78, Anmerkungen 181 und 188
- [2025-014] Stefan Kronthaler: Prophet für das 21. Jahrhundert, in: Sonntag, 2025, 48 (28. November) [neu aufgenommen] - [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-015] Ansgar Martins: Katholizismus als esoterischer Sehnsuchtsort. Siegfried Kracauers "transzendentale Obdachlosigkeit" und die Aporien deutscher Sinn-Suche nach dem Ersten Weltkrieg, in: Viktoria Vitanova-Kerber/Helmut Zander (Hrs.): Esoteric Catholicism/Esoterischer Katholizismus, 2025, S. 331-358 [Artikel] - https://books.google.de/books?id=OhBYEQAAQBAJ&pg=PA347; zu Romano Guardini:
- S. 346 f.: "... Der zweiteilige Bericht von der Ulmer Tagung 1923 beschwor die "neu hervorbrechende Lebenskraft der Kirche",[51 Kracauer, Siegfried: Die Tagung der katholischen Akademiker [I], in: ders.: Werke, Bd. 5.1, 674-677.] die es verstehe, gegenüber der richtungslosen Gegenwart ein Leben in der geordneten "Mitte" zwischen Höherem und Diesseits zu entwerfen. Besonders begeistert war Kracauer von dem Religionsphilosophen Romano Guardini, den er als "Führer" der (von ihm ebenso wie von seinem Romancharakter Georg bewunderten) katholischen Jugendbewegung schätzte und bei dessen Reflexionen zur Liturgie er sich länger beschäftigte. In seiner Rezension zu Guardinis Liturgische Bildung (1923) lobte er die Zeitkritik, von der aus Guardini die gemeinschaftsstiftende Kraft katholischer Sozialisation betone. Guardinis Programm war aber schon eine reflexive "Säkularisierungsfolge": Guardini versuchte nicht zuletzt, der Gefahr einer `Erosion´ katholischer Milieus durch eine erneuerte Messe - und eine komplexe Zeichentheorie religiöser Handlungen - entgegenzukommen, damit die Kirche für Laien wieder attraktiver würde[52 Vgl. Breuer, Marc: Religiöser Wandel als Säkularisierungsfolge. Differenzierungs- und Individualisierungsdiskurse im Katholizismus, Wiesbaden: Springer 2012, 349-435]. Kracauer bezweifelte in einem letzten Schritt, "daß das Einwachsen in liturgisches Tun jene Verknüpfungen wieder herstelle, die Guardini meint",[53 Kracauer, Siegfried: Rezension zu Romano Guardini: Liturgische Bildung. Versuche, Mainz: Deutsche Quickbornhaus 1923, in: Kracauer: Werke, Bd. 5.2, 90-91] denn solche "Verknüpfungen" konnte nur Gott selbst knüpfen."
- S. 349 f.: ...
Papst Franziskus und Guardini
- [2025-016] [Englisch] David H. Delaney: AI, the Technocratic Paradigm, and Integral Human Fulfillment, in: The Catholic World Report, 2025, 29. März [Artikel] - https://www.catholicworldreport.com/2025/03/29/ai-the-technocratic-paradigm-and-integral-human-fulfillment/
- [2025-017] Papst Franziskus: Hoffe. Die Autobiographie, 2025 [Monographie] (in 80 Ländern und zahlreichen Sprachen publiziert) - https://www.google.de/books/edition/Hoffe/fxkrEQAAQBAJ; zu Romano Guardini:
- Im Abschnitt "8 Das Leben ist die Kunst der Begegnung" heißt es: "Oder wie Romano Guardini schreibt, ein großer Theologe, der in Italien geboren wurde, aber schon als Kind nach Deutschland kam: "Der Mensch ist so geschaffen, daß er sich selbst zunächst in einer `Anfangsform´ gegeben ist; in einem Entwurf auf das Leben hin. Hält er den fest, bleibt er bei sich; tritt er nie in die Hingabe ein, dann wird er immer enger und dürftiger. Er `hat seine Seele festgehalten´ und verliert sie dadurch immer mehr."" (Zitat aus: Guardini, Ethik)
- Im Abschnitt über das Volk als "mythische und historische Kategorie" nimmt er wieder Bezug auf Dostojewski und das Dostojewski-Buch Guardinis: "Ich habe Dostojewski immer geliebt, schon als Junge. Und seit ich Rektor an der Fakultät für Philosophie und Theologie in San Miguel war, konnte ich mich auch für die Studien begeistern, die Romano Guardini zu diesem großen russischen Dichter und seiner Welt geschrieben hat. Das Volk von Dostojewski und Guardini ist ein "mythisches Wesen", ohne jede Idealisierung. So sehr diese Menschen auch sündigen und leiden mögen, sie stehen für eine authentische Menschheit."
- Dann berichtet er über die Vorbereitung des Vortrages zur KI auf dem G7-Treffen 2024: "Als ich über meinem Vortrag zur KI saß, den ich im Juni 2024 auf dem G7-Treffen im apulischen Borgo Egnazia vor zahlreichen Regierungschefs halten sollte, fiel mir Romano Guardini ein, der Theologe, dessen Denken mir oft geholfen hat. Ich wollte das Thema von allen Untergangsbeschwörungen befreien, die uns so oft lähmen, von der Starrheit, die sich dem "Neuen" entgegenstellt in dem sinnlosen Versuch, eine Welt bewahren zu wollen, die zum Verschwinden verurteilt ist. Gleichzeitig aber wollte ich deutlich machen, das es in unserer Verantwortung liegt, sensibel für all das zu bleiben, was zerstörerisch und unmenschlich ist."
- Schließlich wird in den Erläuterungen, vermutlich ein Entwurf zur später tatsächlich gehaltenen Rede, auch Guardini genannt und zitiert: "Mit Guardini können wir sagen, dass jedes Problem technischer, sozialer oder politischer Natur "nur vom Menschen her zu lösen ist. Ein neues Menschentum muss erwachen, von tieferer Geistigkeit, neuer Freiheit und Innerlichkeit." (Zitat aus: Guardini, Die Technik und der Mensch) - Und etwas weiter heißt es im Text über das "Anti-Herz" des Narzissmus und der Selbstbezogenheit: "In der Folge werden wir unfähig, Gott zu empfangen, weil wir - wie Heidegger gesagt hätte -, um das Göttliche zu empfangen, ihm ein Gästehaus errichten müssen. Und das Gleiche gilt auch für uns, wenn wir auf unsere authentische und wahre Essenz reagieren wollen. Wenn das Herz nicht lebe, schreibt Guardini in seinem Aufsatz über Dostojewski, bleibe der Mensch sich selbst fremd."
- Rezensionen:
- [2025-018] Gerhard Oberkofler: „Sunt lacrimae rerum…“ Randbemerkungen zu einigen Träumen in der Autobiographie „Hoffe“ (2025) von Papst Franziskus, in: Zeitung der Arbeit, 2025, 26. Februar [Rezension] - https://zeitungderarbeit.at/feuilleton/sunt-lacrimae-rerum/; zu Romano Guardini:
- "Der 1910 zum Priester geweihte und seit 1947 zuerst in Tübingen, dann in München „christliche Weltanschauung“ lehrende Romano Guardini (1884–1968)[44 ...] wird von Papst Franziskus wiederholt mit Sympathie genannt, zumal er über dessen idealistische Dialektik während seines Aufenthaltes in St. Georgen (Frankfurt a. M.) eine wissenschaftliche Arbeit schreiben wollte." [Anmerkung HZ: Guardinis Gegensatzlehre ist keine "idealistische Dialektik"]
- "Romano Guardini war im Einklang mit Rainer Maria Rilke (1875–1926), der in eine katholische Ausformung des Existentialismus flüchtete. 1941, also in einer Zeit, als die aggressivsten Teile des deutschen Kapitalismus zusammen gefunden haben, um mit Adolf Hitler (1889–1945), dessen autobiographische Kampfschrift im deutschen Volk massenhafte Verbreitung gefunden hat,[51] den mörderischen Aggressionskrieg gegen den Osten zu führen, hat Guardini eine konservativ katholische Deutung der Elegien von Rilke über Angst und Sein gegeben.[52 ...] Dabei ist er auf die liebevollen Ansichten von Rilke über die „russische Seele“ und der „Gotterwähltheit des russischen Volkes“ nicht eingegangen.[53 ...] In seinen Vormerkungen zu seiner 1953 veröffentlichten, seiner Mutter zum einundneunzigsten Geburtstag gewidmeten Rilke-Monographie nimmt Guardini auf die von ihm mit erlebte deutsche Barbarei der vergangenen Jahre überhaupt keinen Bezug.[54 ...] Papst Franziskus, der als Jesuitenfrater besonders für Literatur und Psychologie ausgebildet worden ist, wird über den in diesen Jahren in der römisch-katholischen Welt modernen Guardini eine immersive Nähe zu Rilke gespürt und Sympathien für den christlichen Existentialismus entwickelt haben. Nur so wird verständlich, dass er seiner Autobiographie eine in einem Brief niedergeschriebene Sentenz von Rilke voranstellt: „Aber es sprechen viele Anzeichen dafür, dass die Zukunft in solcher Weise in uns eintritt, um sich in uns zu verwandeln, lange bevor sie geschieht“.[55 ...] [Anmerkung Helmut Zenz: Guardini war weder im "Einklang", noch im Zwieklang mit Rilke; Guardini kritisiert deutlich Rilkes säkularisierte Verwendung des christlichen Erbes. Auch bezweifle ich, dass Rilke als "katholische Ausformung des Existentialismus" gesehen werden kann." Schließlich muss man nicht immer ausdrücklich auf etwas Bezug nehmen, um etwas zu sagen. Guardinis Beschäftigung mit Rilke während des Dritten Reiches war Abstandnahme genug, da Rilke als "undeutsch" galt.]
- "Eine liebevolle Zuneigung pflegte Papst Franziskus seit seiner Jugend zum russischen Weltliteraten Fjodor M. Dostojewski (1821–1881), der in seiner von Krisen durchzogenen Epoche als Dichter entscheidende Fragen über die unmenschliche Funktion eines ganzen herrschenden Systems zu stellen in der Lage war. Fern jeder Reflexion der Wirklichkeit, die zur Theologie gehören sollte, ist der Satz von Papst Franziskus: „Wenn das Herz nicht lebe, schreibt Guardini in Anlehnung an Dostojewski, bleibe der Mensch sich selbst fremd“ (S. 366). Die im Mittelmeer ertrinkenden Flüchtlingskinder, die vielen palästinensischen, die israelischen Massaker ohne Eltern überlebenden und verwundeten Kinder oder die im kongolesischen Bergbau für den Reichtum des Westens arbeitenden Sklavenkinder können das „persönliche Abenteuer“ ihres Herzens nicht erleben." [Anmerkung Helmut Zenz: Ob Oberkofler die Wirklichkeit des Herzens gerade auch in der geschundenen Person eines Volkes nicht kennt oder nur nicht kennen will? Insgesamt scheint Oberkofler vom dialogischen Personalismus wenig zu halten oder ihn nicht zu kennen.]
- "Im Einvernehmen mit Guardini findet er bei Dostojewski das „mythische Wesen“ des Volkes ohne jede Idealisierung ausgedrückt (S. 223). Für Papst Franziskus ist das Volk „letztlich keine logische Kategorie. Aber auch keine mystische, wenn wir es so verstehen, dass alles, was das Volk sagt oder tut, selbstverständlich gut und gerecht ist, was ein Merkmal der Seligen wäre. Nein. Das Volk ist höchstens eine mythische Kategorie. Eine mythische und historische. Das Volk wird zum Volk durch einen Prozess, durch Anstrengung, die auf ein Ziel oder ein gemeinsames Projekt gerichtet ist. Die Geschichte ist geprägt von diesem langsamen Prozess, der sich innerhalb der aufeinanderfolgenden Generationen vollzieht“ (S. 222 f.). Papst Franziskus warnt davor, dass „häufig die Mächtigen, um sich selbst zu rechtfertigen, vor allem, wenn sie ihre Macht illegitim oder ungerecht ausüben“, die Geschichte ihrer Nation verfälschen. (S. 223)."
- [2025-019] Papst Franziskus Vorwort, in: Angelo Scola, Warten auf einen neuen Anfang, 2025 [Artikel] - https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2025-04/vorwort-buch-papst-franzisikus-alter-tod-ewigkeit-scola-vatikan.html; zu Romano Guardini:
- "Wenn wir diese Zeit des Lebens als Gnade und nicht mit Groll leben; wenn wir die Zeit (auch eine lange Zeit), in der wir die nachlassenden Kräfte, die zunehmende Müdigkeit des Körpers, die nicht mehr der Jugend entsprechenden Reflexe erleben, mit einem Gefühl der Dankbarkeit begrüßen, dann wird auch das Alter zu einem Zeitalter des Lebens, wie Romano Guardini uns gelehrt hat, das wirklich fruchtbar ist und das Gutes ausstrahlen kann."
- [2025-020] [Spanisch] José Luis Olimón Nolasco: Tensión polar y Ternura: categorías clave en Francisco, in: Meridiano.mx, 2025, 7. Mai [Artikel] - https://meridiano.mx/2025/05/07/tension-polar-y-ternura-categorias-clave-en-francisco/
- [2025-021] [Englisch] Maurits Potappel: The influence of Romano Guardini on Pope Francis, in: ICP Essays, 2025, April [Artikel] - https://www.institutecp.com/essays/the-influence-of-romano-guardini-on-pope-francis
- [2025-022] Michael Sievernich: Die vier Prinzipien des Papst Franziskus, in: Stimmen der Zeit, 150, 2025, S. 139-149 [Artikel] - [noch nicht online]; darin auch Bezüge zu: Guardini, Der Gegensatz
- [2025-023] [Englisch] Antonio Spadaro: Francis, the Romantic Pope, in: Catholic Outlook, 2025, 28. August [Artikel] - https://catholicoutlook.org/francis-the-romantic-pope/
- "Francis’s thinking never calcified into a catechism of bullet points. Rather than denying intellectual and spiritual tensions, he inhabited them. He was unafraid of complexity; in fact, he sought it out. He preferred not “balance” but the harmony of “polar oppositions,” in a line of intuition that joins St. Basil to Romano Guardini."
Papst Leo XIV. und Guardini
- [2025-024] [Italienisch] Francesco Borgonovo: Con il Papa americano è tornato il mistero, sulla scia di Ratzinger e Romano Guardini, in: La Verità, 2025, 16. Mai [Artikel] - https://www.laverita.info/papa-americano-tornato-mistero-2672025730.html
- [2025-026] Leo XIV and the Grammar of the Sacred: Evangelizing Through Gestures, in: Silere non possum, 2025, 17. Oktober [Artikel] - https://silerenonpossum.com/en/leonexiv-lagrammaticadelsacro/; zu Romano Guardini:
- "[...] Romano Guardini, in his classic The Spirit of the Liturgy, defined worship as “dogma prayed.” He explained that Christian truth, to be alive, must take on body, space, gesture, color. “The whole divine reality must be translated into expressive appearance,” he wrote, because Christianity is not an idea but an incarnate event. Every vestment, every architectural line, every ritual movement — Guardini continues — must respond to an inner necessity, becoming “eloquent.” [...] As Guardini wrote, liturgy is “the supreme form of Christian art,” uniting measure and glory, visible and invisible. Solemnity, therefore, is not theater, but formation of the gaze — it teaches that the mystery of God deserves the finest of creation. In this sense, Leo XIV is not “reintroducing obsolete symbols.” He is reminding us that in the liturgy, form is part of content. [...] Guardini insists: in the liturgy, “one does not say ‘I’ but ‘we’.” The subject of worship is the entire Church, not the individual. The vestment, in this perspective, is not a mask but an antidote to vanity, freeing the person from protagonism and inserting him into a received, shared language. [...] Simplicity without form becomes neglect; form without simplicity becomes ostentation. Leo XIV seeks a deeper balance — that “sober intoxication of the Spirit,” as Guardini called it. This is not an aesthetic detail, but a principle of governance. [...] No self-indulgence, no theatrics — only the awareness that every true gesture becomes prayer. That is what makes these signs not objects of debate, but a living language of faith. As Guardini again writes, the liturgy is not a sum of actions but “a life flowing from God to man and back to God.” In that flow, vesture, gesture, music, and word unite as members of one body. [...]"
Zum 140. Geburtstag
- [2025-023] Marco Fetke: Horchen auf die leise Stimme Gottes. Es lohnt sich, Romano Guardini zu lesen, denn sein Glaube ist zeitgemäß im besten Sinne, in: Die Tagespost, 2025, 23. Februar [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-024] Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: Guardinis 140. Geburtstag: Über den Kampf Gottes mit dem Menschen. Als Romano Guardini sich der Frage der „neuen Schöpfung" widmete, offenbarte er zugleich sein Gottesbild, in: Die Tagespost, 2025, 15. Februar [Artikel] - https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-70961720.pdf
- [2025-025] Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: Heidnisches und christliches Europa in Gegenspannung: Zum 140. Geburtstag Romano Guardinis (1885–1968), in: Communio, 54, 2025, S. 431-439 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-026] Marc Grießer: Zum Gedenken an Romano Guardini an seinem 140. Geburtstag, in: Stickeria, 2025, zum 17. Februar 2025 - https://www.stickeria.de/scl/berichte/ewExternalFiles/Guardini_140.pdf
- [2025-027] Interview von Regina Einig mit Johannes Modesto: „Es ist nichts Verwerfliches, zu zweifeln". Der Postulator für diözesane Seligsprechungsverfahren in der Erzdiözese München und Freising, Johannes Modesto, erklärt, warum Romano Guardini ohne Zweifel ein würdiger Seliger ist, in: Die Tagespost, 2025, 16. Februar [Artikel] - https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-70961720.pdf
- [2025-028] [Niederländisch] Lieve Wouters: Wijsheid van Romano Guardini op 140ste geboortedag: ‘Opnieuw wereld scheppen, nu uit eigen chaos’. Ongelooflijk hoe actueel deze tekst van precies 100 jaar geleden is! Cultuurfilosoof Romano Guardini over de uitdaging van moderne technologie, in: Otheo, 2025, 17. Februar [Artikel] - [noch nicht online]
Guardini-Tag 2025 "Vom Sinn des Betens"
- Gregor Maria Hanke OSB: Predigt im Eröffnungsgottesdienst in St. Ludwig in München [Predigt]
- [2025-000] Auftaktpodium "Vorschule des Betens". Bischof Gregor Maria Hanke OSB im Gespräch mit Akademiedirektor Dr. Achim Budde - https://www.youtube.com/watch?v=U1dQEDRGYZo
- [2025-000] Ludger Schwienhorst-Schönberger: Die Psalmen und das Gebet der Sammlung, in: Zur Debatte, 2025, 4, Online-Teil [Vortrag]/[Artikel] - https://kath-akademie-bayern.de/wp-content/uploads/debatte_2025-4.pdf
- [2025-000] Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: Das Jahr des Herrn im Rosenkranz. Zur Beziehung von Christologie und Mariologie bei Guardini, in: Zur Debatte, 2025, 4, Online-Teil[Vortrag]/[Artikel] - https://kath-akademie-bayern.de/wp-content/uploads/debatte_2025-4.pdf https://kath-akademie-bayern.de/mediathek-eintrag/das-jahr-des-herrn-im-rosenkranz-zur-beziehung-von-christologie-und-mariologie-bei-romano-guardini/
- Gabriel von Wendt: Wie spricht Gott? Guardinis melodisches Verständnis von Gebet, Gemeinschaft und Spiritualität [Workshop-Impuls]
- Stefan K. Langenbahn: Die erste Krise der Liturgischen Bewegung (1919). Oder: Warum Guardini die „Vorschule des Betens“ (1943) seinem Freund Cunibert Mohlberg OSB widmete [Workshop-Impuls]
- Ulrich Pohlmann: Zweifel am Gebet? [Workshop-Impuls]
- Yvonne Dohna Schlobitten: Gebet und Stille im Denken Guardinis [Workshop-Impuls]
- Sandra Gold: Film "Wo ist Gott?" mit Impulsen von Regisseurin Sandra Gold aus München
- [2025-000] Christian Lehnert: Die Sprache des Gebets an der Grenze des Sagbaren [Vortrag] - https://www.youtube.com/watch?v=O4UrK2K_dsY
- Podiumsgespräch zwischen Christian Lehnert, Sandra Gold und Patrik Scharz (Moderation)
- [2025-000] Wolfgang Augustyn: Wie soll man beten? Beispiele aus der Kunst, in: Zur Debatte, 2025, 4, Online-Teil [Vortrag]/[Artikel] - https://kath-akademie-bayern.de/wp-content/uploads/debatte_2025-4.pdf
- Thomas Brose: Nur wer Gott kennt, kennt den Menschen. „Nicht die Anstrengung, sondern die Anbetung ist das Endgültige“. Auf dem Weg zu einer vertieften kontemplativen Haltung [Vortrag]
- Helmut Zenz: Romano Guardini in München. Ausgewählte Stationen von Heilig Blut in Bogenhausen bis in den Lichthof der Universität [Führung]
- Reaktionen:
- [2025-028] Katholische Akademie in Bayern: Pressemitteilung, 2025, vor dem 22. Februar [Artikel] - [noch nicht online] , gedruckt unter dem Titel:
- [2025-031] Sebastian Ostritsch: Guardini-Tagung: „Eine Wand ist durchstoßen“. Zum Christsein, ja sogar zum Menschsein überhaupt gehört das Gebet wesentlich dazu. Davon war Romano Guardini überzeugt. Doch wie betet man eigentlich richtig? Eine Tagung an der Katholischen Akademie in Bayern gab Antworten, in: Die Tagespost, 2025, 1. März [Artikel] - https://www.die-tagespost.de/leben/aus-aller-welt/eine-wand-ist-durchstossen-art-261034
- [2025-032] Ägidius Engel: Vom Sinn des Betens, in: Ägidius Engel: Guardini-Blog, 2025, 3. April [Artikel] - https://www.aegidius-engel.de/2025/04/03/vom-sinn-des-betens/
Guardini-Lectures 2024/25
- [2025-033] Hans-Joachim Höhn: Können - Sollen - Dürfen. Religionsphilosophie nach Kant, 2025 [Monographie] - [noch nicht online]
- Ankündigung: "Romano Guardinis Berliner Jahre (1923-1939) sind davon geprägt, sich auf der Höhe seiner Zeit mit Fragen zu beschäftigen, die zu jeder Zeit an der Zeit sind. Der Erfolg, den er dabei für sich verbuchte, legt es nahe, es ihm heute gleichzutun. Allerdings kann es nicht darum gehen, seine zeitbedingten Antworten als (noch) zeitgemäß auszugeben. Worin man Guardini nacheifern kann, ist das Bemühen, vom Nachdenken über die kulturelle Signatur der jeweiligen Zeitumstände zum Bedenken jener existenziellen Konstellationen vorzustoßen, die menschliches Dasein und seine Fragwürdigkeit kennzeichnen. Einen Zugang zu dieser Fragwürdigkeit bieten Immanuel Kants Erkundigungen, was der Mensch wissen kann, tun soll und hoffen darf. Höhn unternimmt den riskanten Versuch, Kants Fragen à la Guardini anzugehen und zeitdiagnostisch angelegte Reflexionen mit Gedanken darüber zu verknüpfen, wie es letztlich um den Menschen steht. Dabei ist ein Entwurf zur Religionsphilosophie entstanden, der zugleich die Aktualität und Relevanz zweier Denker belegt, die gegenüber dem Glauben die Interessen der Vernunft und gegenüber der Vernunft die Anliegen des Glaubens vertreten haben."
Romano-Guardini-Preis
- [2025-033] Romano-Guardini-Preis 2024, in: Zur Debatte, 55, 2025, 2, S. 4-17 [Sammelband] - https://kath-akademie-bayern.de/wp-content/uploads/debatte_2025-2.pdf; als Video: https://www.youtube.com/watch?v=YDmw8vWL3Cw
- [2025-034] Achim Budde: Verdient auf allen Ebenen, S. 4-7 [Artikel] - https://kath-akademie-bayern.de/wp-content/uploads/debatte_2025-2.pdf; als Video: https://www.youtube.com/watch?v=YDmw8vWL3Cw; zu Romano Guardini:
- S. 5: "Ob ich faktisch zu meinem Recht komme oder nicht, ob mir im Konkreten Gerechtigkeit widerfährt oder nicht, ob die Menschenrechte in meinem Leben Wirklichkeit sind oder nicht, das macht einen gewaltigen Unterschied! Dieser Gedanke hätte Romano Guardini gefallen. Denn Recht und Gerechtigkeit sind für ihn wichtige Größen, die in seinen Schriften immer wieder aufblitzen. In den berühmten Meditationen zu den Tugenden heißt es: „Das Wort [Gerechtigkeit] hat einen hohen, aber auch tragischen Klang. Schöne Leidenschaft hat sich an ihm entzündet; edelste Großmut ist um seinetwillen geübt worden – aber an wie viel Unrecht erinnert es auch; an wie viel Zerstörung und Leid. Die ganze Geschichte der Menschheit könnte man unter der Überschrift erzählen: ,Der Kampf um die Gerechtigkeit‘.“ Dass übrigens Angelika Nußberger sich seit ihren frühen Münchner Jahren mit dem Werk Romano Guardinis beschäftigt – sie wird nachher noch davon erzählen – das verleiht der heutigen Konstellation einen geradezu familiären Charakter."
- S. 6: "Auf allen Ebenen ist es also spannend beim Thema Menschenrechte. Und auf allen Ebenen braucht es Engagement! Das sah bereits Romano Guardini so, der uns Staatsbürger zur Mitarbeit aufruft: „Die staatsbürgerliche Pflicht enthält nicht nur die zur Achtung vor den Rechten des Andersdenkenden, sondern auch die zum Kampf für das als wahr Erkannte: … für das Rechte“ – so Guardini – für das, was Recht ist."
- Joachim Herrmann: Mit messerscharfem Sachverstand, S. 8 [Artikel]
- "Mit dem Romano-Guardini-Preis werden herausragende Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich im Geiste der Ideen Guardinis hervorragende Verdienste erworben haben. Guardini kennen die meisten als Theologen und Philosophen, aber sein Wirken wies weit über diese Felder hinaus. Literaturwissenschaftliche und pädagogische Betrachtungen gehörten ebenso zu diesem wissenschaftlichen Allroundgenie, auf das wir in Bayern sehr stolz sind. Dabei war Guardini wahrlich kein Repräsentant der Wissenschaft, der sich in den Elfenbeinturm zurückzog. Ihm ging es immer um den modernen Menschen – und wie er sich in der so unübersichtlichen und komplexen Welt zurechtfindet."
- Andreas Voßkuhle: Eine Powerfrau – Die Laudatio, S. 9-12 [Artikel]
- [2025-035] Angelika Nußberger: Das Ausrufezeichen hinter den Menschenrechten, S. 13-15 [Artikel] - https://kath-akademie-bayern.de/wp-content/uploads/debatte_2025-2.pdf; als Video: https://www.youtube.com/watch?v=YDmw8vWL3Cw; zu Romano Guardini:
- S. 13:
- "Namen gleichen solchen Orten, auch zu ihnen kann man zurückkehren. Der Name, zu dem ich bei der heutigen Feier zurückkehren, mehr noch, heimkommen darf, ist Romano Guardini. In meiner Jugend hatte mein Weg auf erstaunliche Weise immer wieder zu ihm hingeführt. Zunächst – sein Name war bei uns zuhause präsent wie der eines lieben Verwandten, von dem man mit großer Achtung spricht. Es war meine Mutter, die ihn oft erwähnte. Sie war eine jener vielen, die Sonntag für Sonntag in den 50er Jahren seine Predigten in der Ludwigskirche hörte, eine aus jener orientierungslos gewordenen Generation, geboren 1925, eingeschult 1931, und wenig später schon hineingezwängt in die Erziehungsmaschinerie der Nationalsozialisten. Für sie war, so scheint es mir jetzt im Nachhinein, Romano Guardini einer derjenigen, der ihrem Tritt wieder Sicherheit gab, der für sie die Welt mit eindringlichen Worten erklären und ihr geistig Halt geben konnte.
- "Dem Denken Romano Guardinis bin ich selbst nach dem Tod meines Vaters begegnet, als ich 14 Jahre alt war. Der Vater meiner Freundinnen, der Psychiater Dr. Schöne, drückte mir bei einem meiner Besuche ein kleines Bändchen in die Hand – die Duineser Elegien von Rainer Maria Rilke in der hellgrünen schmalen Ausgabe des Insel-Verlags. „Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen.“ Dieser Satz hat mich seither begleitet. Aber annähern konnte ich mich ihm erst in dem Augenblick, in dem ich Romano Guardinis Interpretation oder besser – philosophische Auseinandersetzung damit – las. Diese beiden Texte – Rilke und Guardini – waren mir in meiner Jugend wichtig. Aber dann habe ich sie in ein inneres Schatzkästchen verschlossen, das ich erst jetzt wieder geöffnet habe, als mir die Katholische Akademie in Bayern den Romano-Guardini-Preis zusprach. [...] Aber was bedeutet nun ein Denken wie dasjenige von Romano Guardini in unserer Gegenwart? Er hat „Christliche Weltanschauung“ gelehrt, ein Fach, das von den Nationalsozialisten verboten wurde, nach dem Krieg aber als Kompass dienen konnte. Es war ein auf dem Christentum, aber auch auf der literarischen und philosophischen Tradition des Abendlandes beruhendes Denken, das nach Wahrheit in einer alles relativierenden Moderne fragt. Gibt es dieses Denken noch in unserer Zeit? Hat es Gewicht?"
- "Bei der Vorbereitung meiner Ansprache habe ich die Bücher Guardinis zuhause wieder zur Hand genommen und in dem Buch Freiheit, Gnade, Schicksal meine Exzerpte zur Frage, was ein freier Mensch und was eine freie Handlung sei, gefunden: „Wer primär den Charakter der Freiheit trägt, ist der personelle, das heißt, der sich selbst in die Hand gegebene Mensch. Die freie Handlung ist die Weise, wie die Person ihr auf die Freiheit hin bestimmtes Sein zum Akt werden lässt.“ Wenn ich dies jetzt, mit dem Abstand von mehreren Jahrzehnten, lese, scheint mir Guardinis Stil klangvoll, aber auch pathetisch zu sein; ich spüre, wie die Sprache sich inzwischen versachlicht hat und vorsichtiger geworden ist. Aber die Botschaft ist noch wirksam – noch immer geht es um das Verhältnis des Individuums zu sich selbst – der „sich selbst in die Hand gegebene Mensch“ – und das Verhältnis des Individuums zu Staat und Gesellschaft – als Bestimmtsein „auf die Freiheit hin“."
- S. 15: "Die Katholische Kirche hat mit dem Romano-Guardini-Preis Menschen mit sehr unterschiedlichem gesellschaftlichem Wirken geehrt; es ist eine Reihe von sehr großen Namen, neben denen ich nicht bestehen kann. Aber ich denke, der Preis gilt auch den Menschenrechten, die in der Gegenwart bedeutungsvoller denn je sind und die ich als säkulares Spiegelbild des Denkens von Romano Guardini sehe."
- Reinhard Marx: Schlusswort, S. 16 f. [Artikel]
Bearbeiten
80. Geburtstag von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
- [2025-000] Harald Seubert: Über die Macht der Veränderung. Die Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr: eine Frau voller Feuer, jugendlicher Wachheit und einem Blick auf die Wahrheit, in: Die Tagespost, 2025, 22. November [Artikel] - [noch nicht online]
Bearbeiten
Liturgie, Volksfrömmigkeit, Gebet, Christliche Kunst und Architektur
Zu: Liturgiewissenschaft/Liturgische Bewegung
- [2025-036] Julie Adamik: Politik der Unpolitischen. Zur katholischen Liturgischen Bewegung in der Weimarer Republik, 2005 (Weimarer Schriften zur Republik; 27) [Monographie] - https://biblioscout.net/content/10.25162/9783515138086.pdf; zu Romano Guardini besonders 4.1., S. 72-134
- [2025-037] Timo Amrehn: Die sonntägliche Eucharistiefeier – Fest des Lebens. Romano Guardinis Worte zum Sonntag mit einer liturgietheologischen Weiterführung, in: Ex Fontes, 4, 2025, S. 193-252 [Artikel] - https://exfonte.org/index.php/exf/article/view/9256/9673
- [2025-038] Marco Benini: Brannte nicht unser Herz? Pastorale Umsetzung und Prinzipien der liturgischen Bildung nach der Emmauserzählung und dem Apostolischen Schreiben Desiderio desideravi von Papst Franziskus, in: Andreas Redtenbacher/Jürgen Riegel (Hrsg.): Liturgie im synodalen Wandel: Ecclesia de eucharistia auf dem pastoralen Prüfstand, 2025, S. 49-83 [Artikel] - https://books.google.de/books?id=xGZSEQAAQBAJ&pg=PA7; zu Romano Guardini S. 72-74 und 81-82
- [2025-039] Andreas Bieringer: Nüchtern und fromm: Wie Franziskus die Liturgie geprägt hat, in: Communio - Online, 2025, 22. April [Artikel] - https://www.herder.de/communio/spiritualitaet/wie-franziskus-die-liturgie-gepraegt-hat-nuechtern-und-fromm/
- "Allem Eindruck nach wollte Franziskus aber nicht als Papst in die Geschichte eingehen, der durch rigide Liturgiepolitik in Erinnerung bleibt. Desiderio desideravi kann daher auch als Versöhnungsgeste zwischen den liturgischen Lagern gelesen werden. Bemerkenswert ist darin die wiederholte Bezugnahme auf Romano Guardini (1885–1968), zu dem Franziskus eine biografische Verbindung hatte. Mitte der Achtzigerjahre begann er an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen eine Dissertation über den deutsch-italienischen Religionsphilosophen Guardini, ließ diese aber unvollendet. Mit dem Rückgriff auf Guardini schlug er zugleich eine Brücke zu seinem Vorgänger Benedikt XVI. Dieser knüpfte noch als Joseph Ratzinger mit seinem Werk "Der Geist der Liturgie" ebenso an Guardinis Klassiker "Vom Geist der Liturgie" an. Trotz eines unterschiedlichen Zugriffes auf sein liturgisches Denken verbindet beide Päpste die zentrale Frage Guardinis: Wie können moderne Menschen heute wieder "liturgiefähig" werden? In dieser Frage liegt letztlich eine tiefe Gemeinsamkeit beider Pontifikate, trotz aller Unterschiede ihrer liturgischen Akzente. [...] Das liturgische Erbe von Franziskus oszilliert zwischen ostentativer Nüchternheit und tiefer Frömmigkeit. Für ihn war die Einfachheit der liturgischen Inszenierung Garant dafür, die symbolische Sprache des Gottesdienstes für heutige Menschen zu erschließen. Dabei knüpfte Franziskus bewusst an Romano Guardini an, der die Bedeutung der einfachen, ursprünglichen liturgischen Symbole betont hatte, um Menschen einen unmittelbaren Zugang zum Geheimnis Gottes zu eröffnen."
- [2025-040] [Italienisch] Stefano Chiappalone: Deus ludens: da Guardini a Prevost passando per Ratzinger. Un Dio «che gioca»: domenica scorsa il Papa ha ripreso un'ardita espressione patristica per esprimere la convergenza tra fede e sport. Che a sua volta evoca ulteriori riflessioni sulla liturgia..., in: La nuova Bussola, Borgo Pio, Mailand, 2025, 17. Juni [Artikel] - https://lanuovabq.it/it/deus-ludens-da-guardini-a-prevost-passando-per-ratzinger; die besprochene Predigt von Papst Leo XIV ohne Bezug zu Guardini: https://www.vatican.va/content/leo-xiv/de/homilies/2025/documents/20250615-omelia-giubileo-sport.html; im Artikel siehe zu Romano Guardini:
- "L'espressione Deus ludens spalanca la porta a una ulteriore associazione mentale: il concetto di liturgia "come gioco", sia perché dotata di regole sia perché aperta a un mondo "altro" e a un altro fine che trascende quelli della vita di ogni giorno. Romano Guardini la definiva «il santo gioco che l'anima svolge dinanzi a Dio». Incomprensibile per «certe nature gravi e serie (...) che in ogni cosa vedono il compito morale e dovunque cercano il fine» e pertanto «si scandalizzano che la liturgia fissi con tanta minuziosità ciò che si deve compiere prima e ciò che deve avvenire dopo, se a destra o a sinistra, ad alta voce o piano» chiedendosi: «a che pro tutte quelle preghiere e cerimonie?». Ma la liturgia, così come l'arte, spiegava Guardini, «non può essere ridotta soltanto sotto l'angolo visuale della sola finalità pratica», poiché «ha la sua ragione d'essere non nell’uomo, ma in Dio». E come il gioco del bambino «appare sciocco solo a chi non avverte il suo significato o senso e sa vedere la giustificazione d'un atto soltanto negli scopi che se ne possono addurre», così la liturgia «ha cercato con cura infinita, con tutta la serietà del bambino e la coscienziosità rigorosa del vero artista, di dar espressione in mille forme alla vita dell’anima, vita santa alimentata da Dio, mirando a null'altro se non a che essa vi possa dimorare e vivere». Il fine c'è, ma è al di là di questo mondo: «la vita eterna non sarà che il compimento di questo gioco. E chi non comprende questo, potrà afferrare poi che il compimento celeste della nostra vita è "un cantico eterno di lode"? Non finirà costui per rientrare nella categoria delle persone attive, che trovano inutile e noiosa tale eternità?»."
- [2025-041] [Portugiesisch] Felipe Sérgio Koller: Questão formativa e questão litúrgica em Romano Guardini: formação litúrgica hoje para além da autorreferencialidade, in: Atualização Litúrgica, 7, 2025, S. [Artikel] - https://books.google.de/books?id=LLZCEQAAQBAJ&pg=PT18
- [2025-042] Benedikt Kranemann: Liturgiefähigkeit. Anmerkungen zu einem schillernden Begriff, in: Thomas Melzl/Konrad Müller (Hrsg.): Gottesdienst im Leben der Kirche: Erkundungen, 2025, S. 147-166 [Artikel] - https://books.google.de/books?id=hSRTEQAAQBAJ&pg=PA148; zu Romano Guardini S. 147-151, 154 und 164
- [2025-043] Eusebius Martis: Sixty Minutes in the Liturgical Escape Room: Decoding Desiderio Desideravi’s “stupor” and “mysterium”, in: Adoremus, 2025, September [Artikel] - https://adoremus.org/2025/09/sixty-minutes-in-the-liturgical-escape-room-decoding-desiderio-desideravis-stupor-and-mysterium/
- [2025-044] [Portugiesisch] Damásio Raimundo Santos de Medeiros: Como estudar liturgia: relação epistemológica entre Romano Guardini e Ione Buyst, in: Penha Carpaedo/Márcio Pimentel (Hrsg.): Ione Buyst. Uma vida a serviço da liturgia, 2025, S. 107-120 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-045] [Italienisch] Domenico Messina: L'attesa: Liturgia e spiritualità dell’Avvento, 2025 [Monographie] - https://books.google.de/books?id=0yFOEQAAQBAJ&pg=PT15; zu Romano Guardini mindestens S. ??? (S. 15 f., 87 und Anmerkungen auf S. 137, 161-163)
- [2025-046] [Portugiesisch] Emundo Noir: O caráter racional da liturgia, in: Cybermonochrome, Blogspot, 2025, 27. Juli [Artikel] - https://cybermonochrome.blogspot.com/2025/07/o-carater-racional-da-liturgia.html
- [2025-047] Stephan Schmid-Keiser: Gottesdienst mit Knopf im Ohr: Über eine neue Art der Hinführung in die Welt der Liturgie, in: Kath.ch - News, 2025, 2. Februar [Artikel] - https://www.kath.ch/newsd/gottesdienst-mit-knopf-im-ohr-ueber-eine-neue-art-der-hinfuehrung-in-die-welt-der-liturgie/; zu Romano Guardini:
- "Umso mehr können Einsichten und Impulse der liturgischen Theologie des zu seiner Zeit bekannten Religionsphilosophen Romano Guardini (1885-1968) neue Wirkung erzielen. Als Seelsorger sprach er den Einzelnen ihre persönliche Beziehung zu Gott bzw. Christus zu, welche sie in ein liturgisches «Wir» als Gemeinschaft der Feiernden einbindet. Es war für ihn selbstverständlich, dass dies unter der Leitung von Amtspersonen geschieht. Bemerkenswert war jedoch sein Grundsatz, dass die «Kirche in der Seele» erwache. «Wende zum Subjekt» - Dazu meinte Karl Rahner, dass Guardini für die spätere «Wende zum Subjekt» in der allgemeinen Seelsorge eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte. Der Titel eines der Guardini-Vorträge in den frühen 1920ern lautete denn auch: «Das Erwachen der Kirche in der Seele». Wie selbstverständlich hob Guardini damit auf das einzelne Subjekt ab und formulierte nicht besitzergreifend, die Kirche erwache in den Seelen. Was sich daraus ergibt? Ich meine nicht wenig: Denn die Diskussion um die faktische Kirche und ihre Funktion im gesellschaftlichen Leben, aber auch das Gespräch um die Verschiedenartigkeit in der Ausgestaltung der christlichen Kirchen und ihrer Ämter – ihr Status als Geschwisterkirchen miteingeschlossen! – kann sich heute nicht dem nötigen Respekt vor jeder einzelnen Seele verschliessen. Seele keinen Gehorsam aufzwingen - Keiner Seele soll Gehorsam aufgezwungen werden, keiner einzelnen Person verunmöglicht werden, ihre Glaubenserfahrung in die real existierende Kirche einzubringen. Kirche lebt aus der Glaubenserfahrung ihrer Subjekte, wie Guardini in einem weiteren wegleitenden Satz folgerte: «Wenn dieser Vorgang der ‹kirchlichen Bewegung› voranschreitet, so muss er zu einer Erneuerung des Gemeindebewusstseins führen. Das ist die gegebene Weise, wie die Kirche erfahren wird. Dass der einzelne mit ihr lebe, sich für sie mitverantwortlich wisse, für sie arbeite, ist der Massstab seiner wahren – nicht geredeten – Kirchlichkeit. Die verschiedenen Lebensäusserungen der Pfarrgemeinde selbst freilich müssen so sein, dass der einzelne das auch könne.» Leitfragen Guardinis zur liturgischen Bildung - Viel später äusserte sich Romano Guardini 1964 in seinem berühmt gewordenen Brief über «den Kultakt und die gegenwärtige Aufgabe der liturgischen Bildung»: Es gehe in Wahrheit «um sehr viel mehr; um einen ganzen Akt, eine ganze Akt-Welt, die verkümmert sind und nun neu aufleben sollen.» Er hoffte darauf, dass nach dem Konzil «die so wunderbar geöffnete liturgische Möglichkeit auch zu wirklichem Vollzug wird. Ob sie sich damit erschöpft, Verbildungen zu beseitigen, neuen Situationen zu genügen, bessere Unterweisungen zu geben, was Vorgänge und Dinge bedeuten – oder ob ein vergessenes Tun wieder gelernt und verlorene Haltungen neu gewonnen werden», dies forderte ihn selbst heraus. An der Schwelle zur Bearbeitung der Erneuerung liturgischer Formen stehend bemerkte Guardini: «Hier wird sich natürlich auch die Frage erheben, ob die geltende Liturgie Bestandteile enthält, die vom heutigen Menschen nicht mehr recht realisiert werden können. … Solange die liturgischen Handlungen nur objektiv ‹zelebriert›, die Texte nur lesend ‹persolviert› werden, geht alles glatt, weil nichts in den Bereich des religiösen Vollzugs kommt. Sobald aber der Vorgang den Ernst des Gebetes gewinnt, zeigt sich, was in lebendiger Weise nicht mehr realisiert werden kann.» Und weiter: «Wie ist der echte liturgische Vorgang geartet – im Unterschied zu anderen religiösen Vorgängen, dem individuellen und dem sich frei bildenden Gemeinschaftsvorgang der ‹Volksandacht›? Wie ist der tragende Grundakt gebaut? Welche Formen nimmt er an? Welche Fehlgänge bedrohen ihn? Wie verhalten sich die Anforderungen, die er stellt, zur Struktur und zum Lebensbewusstsein des heutigen Menschen? Was muss geschehen, damit dieser ihn in echter und redlicher Weise lernen könne?» Zur seither berühmten «Guardini-Frage» gelangte er mit seinen vorausschauenden Bemerkungen: «… Probleme und Aufgaben genug, – falls man nicht, der Klärung wegen, an den Anfang die Frage stellen müsste: Ist vielleicht der liturgische Akt, und mit ihm überhaupt das, was ‹Liturgie› heisst, so sehr historisch gebunden – antik, oder mittelalterlich -, dass man sie der Ehrlichkeit wegen ganz aufgeben müsste? Sollte man sich vielleicht zu der Einsicht durchringen, der Mensch des industriellen Zeitalters, der Technik und der durch sie bedingten psychologisch-soziologischen Strukturen sei zum liturgischen Akt einfach nicht mehr fähig? Und sollte man, statt von Erneuerung zu reden, nicht lieber überlegen, in welcher Weise die heiligen Geheimnisse zu feiern seien, damit dieser heutige Mensch mit seiner Wahrheit in ihnen stehen könne?» Formales Organisieren genügt nicht - Und abrundend: «Sehr ernste Erzieher haben darauf hingewiesen, dass für die Bildung gerade des heutigen Menschen blosses Sagen, intellektuelles Erklären, formales Organisieren nicht genügen. Dass die Organe des Schauens, des Tuns, des Gestaltens geweckt und in den bildenden Vorgang einbezogen werden müssen; dass das musikalische Moment mehr ist als eine blosse Verzierung; dass die Gemeinschaft anderes bedeutet als ein Zusammensitzen, vielmehr Solidarität im Akt der Existenz und sofort.» Grund genug – angesichts der neuen Methode eines Audioguide beim «Gottesdienst mit Knopf im Ohr»– weitere Schritte der Vertiefung bei der liturgischen Bildung zu gehen."
- [2025-048] [Italienisch] Laura Vedelago: La preghiera come forma liturgica in Romano Guardini, in: Rivista di pastorale liturgica, 2025, 3=370, S. 15-20 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-049] Stephan Winter: „Die Religion des nachchristlichen Judentums“ „ein rätselhaftes Un-Wesen“ (Romano Guardini): Wort Gottes, Israeltheologie und übernatürliche Offenbarung in ausgewählten Positionsbestimmungen der Liturgischen Bewegung, in: Bibel und Liturgie, 2025, Heft: Internationales Pius-Parsch-Symposion (4.:2024: Klosterneuburg), S. 21-50 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-050] Alexander Zerfaß: „Die Geschichte Christi vollzieht sich in dem verkündeten Wort.“: Zur Theologie der Schriftverkündigung bei Odo Casel; mit einem Seitenblick auf Romano Guardini und Pius Parsch, in: Bibel und Liturgie, 2025, Heft: Internationales Pius-Parsch-Symposion (4.: 2024: Klosterneuburg), S. 75-92 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-049] Markus Zimmer: Gottesdienst als Wir-Ich-Du-Ereignis. Sein Mut, die Messe mit Jugendlichen anders zu feiern, machte Romano Guardini zum Pionier für die Liturgiereform im Zweiten Vatikanischen Konzil, in: Forum. Magazin der katholischen Kirche im Kanton Zürich, 2025, 5. März [Artikel] - https://www.forum-magazin.ch/magazin/20250305-gottesdienst-als-wir-ich-du-ereignis/ (mit zwei stilisierten Zeichnungen Guardinis von Agata Marszałek)
Zu: Christliche Kunst und Architektur
- [2025-048] [Italienisch] Enrico Beltramini: Sacred Reality, Digital Simulation. Ritual Form in Virtual Spaces, 2025 [Monographie] - https://books.google.de/books?id=2jB1EQAAQBAJ&pg=PA33; zu Romano Guardini S. 33-36 (3.1 Guardini´s Ambivalence), 48-51 (Participation and Rite), 90, 124, 153
- [2025-049] Erich Garhammer: Romano Guardini: Das Einfache ist nicht simpel, in ders.: Spitz-fündig. Plädoyer für einen poetischen Glauben. Würzburg, Echter 2025, S. 23-30 [aufgenommen auf Hinweis von Dr. Zahner] - [Artikel] - [noch nicht online]; (Hinweis auf Einfluß von Guardinis "Briefen vom Comer-See; ähnlich schon mehrfach im Jahr 2021)
- [2025-050] Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: Leibhafte Verankerung im Irdischen. Orte des Heiligen, in: Andreas Renz/Helga Schiffer/Winfried Verburg (Hrsg.): Wegmarken. Religion - Kultur - Spiritualität. Festschrift für Michael Langer, 2025, S. 199-207 [Artikel] - https://www.google.de/books?id=8lU5EQAAQBAJ; zu Romano Guardini S. 206 f.(Verweis auf Guardini, Von heiligen Zeichen)
- [2025-051] Benjamin Leven: Orientierungslos: Zur Debatte um die Berliner Hedwigskathedrale, in: Communio, 2025, 10. Januar [Artikel] - https://www.herder.de/communio/spiritualitaet/zur-debatte-um-die-berliner-hedwigskathedrale-orientierungslos/; darin Zitat aus Guardini, Besinnung vor der Feier der heiligen Messe; und auf Guardini, Vom Geist der Liturgie)
Bearbeiten
Christliche Musik/Kirchenmusik
Rezensionen zu: Von Heiligen Zeichen (1922/1925)
Bearbeiten
Rezensionen zu: Das Gebet des Herrn (1932)
Bearbeiten
Bearbeiten
Jugendbewegung
- [2025-054] Gerhard Oberkofler: Im Kampf um die Jugend in Kriegszeiten, in: Zeitung der Arbeit, 2025, 3. August [Artikel] - https://zeitungderarbeit.at/feuilleton/im-kampf-um-die-jugend-in-kriegszeiten/; zu Romano Guardini (in einer sehr einseitig atheistisch und kommunistisch geprägten Kritik, die sowohl Juventus als auch Quickborn historisch falsch in die Jugendbewegung einordnet):
- "Der katholische Priester Romano Guardini (1885–1968) entwarf 1920 für die katholische Kirche ein widersprüchliches Konzept, um in der Jugend für das Christentum und die katholische Kirche tätig zu werden. Die durch Zusammenwirken von Sozialdemokratie und reaktionären bis erzreaktionären Kräften in Deutschland und Österreich zu Ende gegangene, vom revolutionären Aufbruch geprägte Situation nach 1917 sollte den davon enttäuschten Jugendlichen einen demütigen, angepassten und zugleich elitären Sehnsuchtsort mit „dreimal ja“ katholisch vermitteln.[4 Romano Guardini: Neue Jugend und katholischer Geist (= Das neue Münster. Baurisse zu einer deutschen Kultur). Matthias Grünewald Verlag Mainz Auflage Sechstes bis Achtes Tausend. 1924] Seine Inspiration erhielt Romano Guardini von einer Mainzer katholischen Jungengruppe, die sich nach der römischen Göttin der Jugendkraft „Juventus“ nannte.[5 Romano Guardini: Aus einem Jugendreich. Matthias Grünewald Verlag in Mainz 1921]"
- [2025-055] Stefan Waanders: Zeitenwende und Burg Rothenfels als Ort der Hoffnung. Zum Artikel von Gereon Vogler in den letzten konturen: Welche Wahrheiten uns nottun. Ein Beitrag zur Diskussion von Stefan Waanders, in: Konturen. Rothenfelser Burgbrief, 2025, 1, S. 17 f. [Artikel] - https://www.burg-rothenfels.de/fileadmin/Mediendatenbank/70_Wer_wir_sind/Burgbrief_konturen/konturen_Burgbrief_01_2025.pdf
- [2025-056] Matthias Werner: Die Kapelle auf Burg Rothenfels … und ihre Ausstattung. Persönliche Überlegungen zu Marienfigur, Kruzifix und Gedenktafein, in: Konturen. Rothenfelser Burgbrief, 2025, 2, S. 21 f. [Artikel] - https://www.burg-rothenfels.de/fileadmin/Mediendatenbank/70_Wer_wir_sind/Burgbrief_konturen/konturen_Burgbrief_02_2025.pdf
Bearbeiten
Pädagogik, Psychologie und Seelsorge (Religionspädagogik und Katechese)
Zu: Die Lebensalter (1953)
- [2025-057] Bruno Preisendörfer: Religion und Reife. Verjüngt sich beim Älterwerden der Glaube? in: NDR Kultur, Glaubenssachen, 2025, 29. Juni [Artikel] - https://www.ndr.de/kultur/sendungen/glaubenssachen/manuskript920.pdf
- "Wie ‚Zukunftsschwund‘ ausgehalten wird, ist ein Kennzeichen für das, was man ‚Altersweisheit‘ oder einfach nüchtern ‚Reife‘ nennen kann. In den Worten des 1968 mit 83 Jahren verstorbenen katholischen Religionsphilosophen Romano Guardini: „Der in der richtigen Weise Altwerdende wird fähig, das Ganze des Lebens zu verstehen. Er hat keine eigentliche Zukunft mehr; so wendet sein Blick sich auf das Vergangene zurück. Er sieht die Zusammenhänge; erkennt, wie darin die verschiedenen Anlagen, Leistungen, Gewinne und Verzichte, Freuden und Nöte durch einander bestimmt werden und so jenes wunderbare Gefüge entsteht, das wir >ein Menschenleben< nennen.“"
Bearbeiten
Bearbeiten
Theologie, Exegese und Mystik
- [2025-058] [Französisch] Vincent Billot: La mission théologique de Romano Guardini. Essai sur l'unité d'une œuvre, Rom 2025 (Chora edizioni) (Diss. theol. Löwen 2024) [Guardini-Monographie] - [noch nicht online]
- [2025-060] [Italienisch] Pier Luigi Cabri/Nicola Gardusi/Fabio Quartieri: «Andare alla sorgente». Percorsi teologici sulla speranza in Romano Guardini, Ghislain Lafont, Christoph Theobald: in: Rivista di teologia dell´ evangelizzazione, 29, 2025, 57 (Januar/Juni 2025), S. 37-69 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-061] Katholische Sonntagsblatt. Das Magazin für die Diözese Rottenburg-Stuttgart: Hoffnungsort: Beten mit Romano Guardini (fünfteilig) [Artikelserie]
- (1) Die Übung der Sammlung. Wie sieht es im Inneren aus?, in: Katholisches Sonntagsblatt, 2025, 4 [Artikel] - https://www.kathsonntagsblatt.de/inhalte.php?jahrgang=2025&ausgabe=4&artikel=6
- (2) Geistliche Übungen. Wir wollen lernen, still zu werden, in: Katholisches Sonntagsblatt, 2025, 5 [Artikel] - https://www.kathsonntagsblatt.de/inhalte.php?jahrgang=2025&ausgabe=5&artikel=6
- (3) Vorschule des Betens. Beten, um seelisch gesund zu sein, in: Katholisches Sonntagsblatt, 2025, 6 [Artikel] - https://www.kathsonntagsblatt.de/inhalte.php?jahrgang=2025&ausgabe=6&artikel=6
- (4) Erwachen der geistlichen Sinne. Wie Gott erfahren werden kann, in: Katholisches Sonntagsblatt, 2025, 7 [Artikel] - https://www.kathsonntagsblatt.de/inhalte.php?jahrgang=2025&ausgabe=7&artikel=6
- (5) Bitte, Dank und Anbetung. Denn Gott wendet alles zum Guten, in: Katholisches Sonntagsblatt, 2025, 8 [Artikel] - https://www.kathsonntagsblatt.de/inhalte.php?jahrgang=2025&ausgabe=8&artikel=6
- [2025-062] [Englisch] Heather King: Why it’s not possible to have a Church without Christ, in: Angelus News, 2025, 27. Juni [Artikel] - https://angelusnews.com/voices/church-without-christ/
- „As Msgr. Romano Guardini observed in his book “The Lord’s Prayer”: “For the believer … what binds in conscience is not only an abstract moral law but something living, which comes from God. It is the holy, the good, which impresses itself upon our inmost souls. … A new dimension, if one may express it so, stands out in the relationship — the creative dimension.” How could we not long with all our hearts to enter into the creative dimension described by Guardini? Who would not want to be in the firm embrace of the Church from which that dimension is generated? We tend to avoid the Church because of what it demands of us, in other words — but what of the innumerable graces and gifts the Church gives to us?“
- [2025-063] Florian Klug: Lumen Gentium and Doctrinal Ambivalence. Abel and the Interpretative Task of Filling the Gaps, in: Massimo Faggioli/Edward P. Hahnenberg/Kristin M Colberg/Catherine Clifford (Hrsg.): The Legacy and Limits of Vatican II in an Age of Crisis, 2025, S. 53-71 [Artikel] - https://books.google.de/books?id=vDtVEQAAQBAJ&pg=PA53; zu Romano Guardini S. 53 und 61
- [2025-064] [Italienisch] Franco Lorusso: Ritessere relazioni in un mondo a pezzi. L'attualità di Nicea alla luce di un testo di Romano Guardini, in: L´ Osservatore Romano, 2025, 26. August [Artikel] - online über Mercaba: https://www.mercaba.es/l%27osservatoreromano/26_agosto_2025.pdf (Bezug zu: Guardini, Il significato del dogma del Dio trinitario per la vita etica della comunità)
- [2025-066] Ulrich Neymeyr: Wann Judas Iskariot hätte gehen müssen. Predigt von Bischof Ulrich am Gründonnerstag, 17. April 2025, in der Severikirche [Artikel] - https://www.bistum-erfurt.de/presse_archiv/nachrichtenarchiv/detail/wann-judas-iskariot-haette-gehen-muessen/ (Bezug zu Guardini, Der Herr)
- "Der 1968 verstorbene Priester, Theologe und Religionsphilosoph Romano Guardini beschreibt in seinem Buch „Der Herr“ sehr eindrücklich die Person des Judas Iskariot: „Judas muss mit einer wirklichen Bereitschaft zum Glauben und zur Nachfolge gekommen sein (…). Er war zum Apostel berufen und konnte auch wirklich einer sein. Dann muss aber die Bereitschaft zur Umkehr erlahmt sein. Wann das geschah, wissen wir nicht; vielleicht in Kafarnaum, als Jesus die Eucharistie verhieß und den Zuhörern die Rede unerträglich schien. Damals wendete sich die öffentliche Meinung von Jesus ab und auch viele seiner Jünger gingen nicht mehr mit ihm. Da muss die Erschütterung bis in den engsten Kreis gedrungen sein, denn Jesus hat die Zwölf nicht umsonst gefragt, wollt auch ihr gehen? Zu glauben im vollen Sinne des Wortes, war keiner von ihnen fähig. Petrus tat das Höchste, was ihnen möglich war, als er sich sozusagen mit einem Sprung ins Vertrauen hinein rettete. (mit der Frage) Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. (…) Vielleicht ist damals der Glaube im Herzen des Judas erloschen. Dass er dann nicht ging, sondern blieb als einer von den Zwölfen, war der Beginn des Verrats. Warum er blieb, kann man nicht sagen. Vielleicht hat er doch noch eine Hoffnung gehabt innerlich durchzukommen oder er hat sehen wollen, wie die Dinge gehen würden.“ soweit Romano Guradini (Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Wirken Jesu Christi (Würzburg 1940), S. 437f.) Romano Guardini schlägt eine Brücke von der großen Brotrede Jesu im sechsten Kapitel des Johannes-Evangelium bis hin zum Letzten Abendmahl. Nach der wunderbaren Brotvermehrung offenbarte sich Jesus als das Brot des Lebens: „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ (Joh 6,34) Dann heißt es weiter: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.“ (Joh 6,51) Als sich daraufhin Protest erhob, fuhr Jesus fort: „Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm.“ (Joh 6,55f.) Nach diesen Worten haben sich viele Menschen von Jesus abgewandt und Romano Guardini ist der Meinung, es wäre der richtige Zeitpunkt auch für Judas Iskariot gewesen, sich von Jesus zu trennen. Aber das hat er nicht getan."
- [2025-067] Stephan Schmid-Keiser: Die «Nachwuchskirche» im Rückspiegel, in: Kath.ch News, 2025, 2. Oktober [Artikel] - https://www.kath.ch/newsd/die-nachwuchskirche-im-rueckspiegel/; zu Romano Guardini:
- "Weg zur «vollen Mündigkeit der Person»: Schon 1950 legte Romano Guardini seinen eindrücklichen Versuch zur Orientierung über «Das Ende der Neuzeit» vor. Das neuzeitliche Weltbild war in Auflösung. Die Einzelnen begannen nach «voller Mündigkeit der Person» zu suchen. Religiosität hatte «immer mehr die unmittelbare Beziehung zum konkreten Leben» verloren und für viele nur noch die Bedeutung, gewissen Kulminationspunkten des Daseins, wie Geburt, Eheschliessung und Tod, eine religiöse Weihe zu geben». Durch die Schwächung seines «natürlichen religiösen Organs» sah der Mensch «die Welt immer mehr als profane Wirklichkeit» mit «weittragenden Konsequenzen». Laut Guardini ersetzte das «moderne Versicherungswesen» den Vorsehungsglauben. Ins Schwarze traf seine Diagnose: «Ohne das religiöse Element wird das Leben wie ein Motor, der kein Öl mehr hat.»
- "Vermehrte Ausübung von Gewalt: Der Kurzschluss, der sich in seinen Augen im Rückspiegel seit den 1920ern vollzogen hatte, war die vermehrte Ausübung von Gewalt, die Wirkung der radikale Verlust an «Mitte und Bindung». Bewusst stand Guardini dazu, dass im Verhältnis zu Gott das Element des Gehorsams stark hervortreten werde, «reiner Gehorsam, wissend, dass es um jenes Letzte geht, das nur durch ihn verwirklicht werden kann, … weil Gott heilig-absolut ist». Dies einzusehen, setzte voraus, dass der Mensch «die Qualität der Gottesforderung in seinen Akt» aufnehme und zur «Mündigkeit des Urteils und Freiheit der Entscheidung» gelange. Es war diese theologische Vorgabe, die Guardini spezifisch zuspitzte. Hier sollte der religiös suchende Mensch «in der wachsenden Einsamkeit der kommenden Welt – eine Einsamkeit gerade unter den Massen und in den Organisationen – lebendige Person» bleiben."
- "War Guardinis Blick auf die Vergangenheit pessimistisch gefärbt, motivierte Merton zur Gemeinschaftsbildung und betonte in der Nachkriegszeit die neue Hoffnung auf das eigene Heil und das Heil der Nächsten."
- [2025-068] [Italienisch] Marcello Semeraro: Santità: Cristo vive nel cristiano, 2025 [Monographie] - https://books.google.de/books?id=PWtgEQAAQBAJ; zu Romano Guardini zahlreiche Seiten
- [2025-069] Karlheinz Tröndle: Meditation - Weg zur inneren Stille: Anleitung zur täglichen Praxis für ein freies Leben, 2025 [Monographie] - https://books.google.de/books?id=rIY7EQAAQBAJ&pg=PA149; zu Romano Guardini im Abschnitt 4.7. Psychische Arbeit und psychischer Widerstand, S. 149 f.
Zu: Bonaventura (1921)
Bearbeiten
Zu: Amore e fede (2025)
- [2025-070] [Italienisch] Giulio Osto: "Introduzione. Ignorare le Scritture è ignorare Cristo. Lo studio della Bibbia anima della teologia", in: Guardini, Amore e fede, hrsg. von Giulio Osto, Brescia 2025, S. 5-13 [Artikel] - [noch nicht online]
Zu: Opera omnia: Ecclesiologia (2025)
- [2025-071] [Italienisch] Giovanni Cerro: Il singolo può esistere solo in rapporto all’altro. Romano Guardini sulla nevralgica relazione fra comunità e individuo, in: L´ Osservatore Romano, 2025, 13. Juni [Rezension] - [noch nicht online]
Bearbeiten
Philosophie, Ethik und Politik (Religionsphilosophie und Moraltheologie)
- [2025-072] [Spanisch] José Antúnez Cid: El paradigma tecnocrático como nueva gnosis, in: Veritas, 61, 2025, S. 68-96 [Artikel] - https://ojs.uc.cl/index.php/veritas/article/view/84438/72156; zu Romano Guardini S. 73 und 76
- [2025-073] [Italienisch] Ilario Bertoletti: Romano Guardini e la libertà cristiana, in: La Voce del Popolo, 2025, 29. Mai [Artikel] - https://www.lavocedelpopolo.it/opinioni/romano-guardini-e-la-liberta-cristiana
- [2025-074] [Italienisch] Guido Bonarelli: Che cos’è democrazia nel pensiero di Romano Guardini, in: Tutti. Europa Ventitrenta, 2025, 20. Juni [Artikel] - https://tuttieuropaventitrenta.eu/2025/06/20/che-cose-democrazia-nel-pensiero-di-romano-guardini/
- [2025-075] [Italienisch] Osman Antonio Di Lorenzo: Dio, natura e cultura: domande sempre attuali, in: Letteratura Capracottese, 2025, Juli [Artikel] - https://www.letteraturacapracottese.com/post/dio-natura-cultura-domande-sempre-attuali
- [2025-076] [Italienisch] Giuliana Fabris: Pietre bianche. Romano Guardini: "Che l’uomo apra alla donna la strada…", 2025 [Monographie] - [noch nicht online]
- Reaktionen und Rezensionen:
- [2025-078] [Spanisch] Rafael Fayos Febrer: Libertad, vulnerabilidad y aceptación. Algunas reflexiones desde el pensamiento de Romano Guardini, in: Scripta theologica, 57, 2025, 2, S. 327-350 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-079] [Spanisch] Rafael Fayos Febrer: Accíon y obra singular en el contexto de una historia (reflexiones en torno a la filosofía y teología de la historia en Romano Guardini), in: Cuadernos CEU-CEFAS, 2025, 12 (Verano de 2025), S. 49-78 [Artikel] - https://books.google.de/books?id=FeqKEQAAQBAJ&pg=PA49
- [2025-080] [Englisch] Pavel Frývaldský: The Trinitarian Mystery of the Word: Ferdinand Ebner and Romano Guardini, in: Eduard Fiedler/Pavel Frývaldský (Hrsg.): Trinitarian Ontologies. Towards a Trinitarian Transformation of Philosophy, 2025, S. 219-244 [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-081] [Italienisch] Andrea Galluzzi: Dentro e oltre lo sguardo. La prospettiva gnoseologica di Romano Guardini, tra opposizione polare e Weltanschauung, verso una dimensione umana del conoscere, in: Marco Luppi/Licia Paglione (Hrsg.): Sul tra. Dialoghi interdisciplinari, Rom 2025, S. 321-339 [Artikel] - [noch nicht online], siehe aber: https://www.tedhu.education/2025/10/dentro-e-oltre-lo-sguardo-la-prospettiva-gnoseologica-di-romano-guardini-tra-opposizione-polare-e-weltanschauung-verso-una-dimensione-umana-del-conoscere/
- [2025-082] [Spanisch] José M. García Pelegrín: Gerl-Falkovitz, crítica del «género»: «El cuerpo es parte integral de la persona, no su propiedad», in: Religion en libertad, 2025, 12. Juli [Artikel] - https://www.religionenlibertad.com/personajes/250712/gerl-falkovitz-genero-cuerpo_112735.html; zu Romano Guardini:
- "¿Qué importancia tiene Romano Guardini hoy en día?: Romano Guardini es un genio. Fue uno de los grandes pensadores del siglo XX. Guardini tiene el don de leer e interpretar las afirmaciones de las Escrituras, que nos son totalmente familiares, desde una profundidad humana. ¡Qué luz y comprensión comienzan a brillar de repente! Eso es lo que hizo en Berlín. Hablaba en la universidad, en aulas repletas, ante personas que en su mayoría no eran cristianas. Existen muchas maneras de hablar sobre la figura de Jesús, pero su libro El Señor es una obra maestra. Es un análisis minucioso que revela los matices ocultos en la figura de Jesús o en los Evangelios, en realidad como hacía San Pablo. »Guardini se refiere al Creador y, más aún, al Redentor. Demostró que la hora de Nazaret es más grande que la hora en que Dios dice: "Hágase". Con el "fiat" de María, su sí a Dios, surge algo nuevo."
- "¿Cómo veía él la naturaleza y la creación?: Para Guardini, la creación es más que la naturaleza. Es una tarea y una misión. El ser humano no debe limitarse a conservar, sino que debe configurar, continuando el proceso de creación. Él nunca diría que la creación debe simplemente conservarse, como si el ser humano debiera preservarla como un espacio salvaje. Guardini es un pensador del futuro. No se pregunta qué se debe evitar, qué no debe hacer, dónde está el límite, sino: ¿cuál es mi misión, la misión creadora de cultivar el jardín, qué debo cambiar? »El ser humano es jardinero, pero también debe trabajar con la creación. Guardini nunca habló de retirarse a un mundo idílico. La verdadera tarea era una labor cultural. El ser humano debe crear cultura."
- "¿Qué pensaba Guardini sobre la Iglesia?: Estaba convencido de que la Iglesia no está terminada, sino en proceso de formación. La historia de la salvación no ha concluido hasta hoy. Por eso decía a los jóvenes: "¡Ahora os toca a vosotros! Tenéis algo que hacer por encargo de Dios"."
- [2025-083] [Italienisch] Andrea Grillo: La pena di morte e la Dignitas infinita. Una risposta al card. Mueller con sorprese su Tommaso d’Aquino e Romano Guardini, in: Munera. Rivista europea di cultura (Blog), 2025, 6. Oktober [Artikel] - https://www.cittadellaeditrice.com/munera/la-pena-di-morte-e-la-dignitas-infinita-una-risposta-al-card-mueller-con-sorprese-su-tommaso-daquino-e-romano-guardini/
- [2025-084] [Italienisch] Pasquale Hamel: Romano Guardini, il Profeta della dignità umana tra fede e resistenza, in: L´identita, 2025, 19. April [Artikel] - https://www.lidentita.it/romano-guardini-il-profeta-della-dignita-umana-tra-fede-e-resistenza/
- [2025-085] Mathias Hühnerbein: Macht und Verantwortung: der Schlüssel zu ethischer Führung, in: Blog von Proceo, 2025, 13. Juni [Artikel] - https://www.proceo.de/blog/macht-und-verantwortung/; zu Romano Guardini:
- "Romano Guardini, einflussreicher Denker des 20. Jahrhunderts, warnte bereits vor einem blinden Glauben an Machtzuwachs als reine Fortschritte in Sicherheit, Nutzen und Lebensqualität. Er betonte, dass Macht eine mehrdeutige Kraft sei, die sowohl Gutes als auch Böses bewirken könne, abhängig von den Absichten und der moralischen Grundlage ihres Gebrauchs. Bereits 1950 schrieb Romano Guardini: „Der neuzeitliche Mensch meint, jede Zunahme an Macht sei automatisch Fortschritt: mehr Sicherheit, mehr Nutzen, mehr Wohlfahrt, mehr Lebenskraft, mehr Wertsättigung.“ Doch Guardini warnt auch: „In Wahrheit ist Macht etwas zutiefst Mehrdeutiges. Sie kann Gutes wie Böses bewirken, aufbauen, wie zerstören. Was sie wird, hängt von der Gesinnung ab, die sie leitet, und vom Zweck, dem sie dient.“ [...] Romano Guardini ergänzte diese Definition [von Max Weber, HZ], indem er Macht als die Fähigkeit beschrieb, Realität aktiv zu gestalten. Macht ist demnach nicht nur eine statische Kraft, sondern eine dynamische, die Menschen dazu befähigt, andere zu Handlungen oder Veränderungen zu bewegen, auch wenn diese nicht unbedingt ihren eigenen Überzeugungen entsprechen. „Macht ist dann gegeben, wenn sie mit bewusster Freiheit verbunden ist – und diese besitzt nur der Mensch.“ Er beschreibt Macht zugleich als: „Fähigkeit, Realität zu bewegen.“"
- [2025-086] [Englisch] Maryann Keating: Romano Guardini Diagnosed the Pride of Our Age — and Looked to the Cure, in: National Catholic Register, 2025, 9. Juni [Artikel] - https://www.ncregister.com/commentaries/maryann-keating-romano-guardini-challenge-of-technology
- [2025-000] Jonas Klur: Wenn Authentizität zum Dogma wird: Die Gefahr eines missverstandenen Lebensideals. Der Selbstentfaltungs-Imperativ im Licht christlicher Anthropologie – und Guardinis Warnung vor einer Ethik, die das Innere unkritisch feiert, in: Die Tagespost, 2025, 7. Dezember [Artikel] - [noch nicht online]
- [2025-088] Josef Kreiml: Den Mut zur Wahrheit haben. Über das neuzeitliche und das christliche Menschenbild, in: Bistum Regensburg News, 2025, 27. Januar - [Artikel] - https://bistum-regensburg.de/news/prof-kreiml-ueber-das-neuzeitliche-und-das-christliche-menschenbild
- [2025-089] [Italienisch] Francesco Marrapodi: Guardini e la visione del mondo: L’uomo credente è l’uomo che vede in una maniera attiva, trasformativa, contemplativa, in: Azione Cattolica Italiana, 2025, 21. Juli [Artikel] - https://azionecattolica.it/guardini-e-la-visione-del-mondo/
- [2025-090] [Englisch] Regis Martin: Doing Politics Without God. The United States, founded upon freedom of religion, has turned rather into freedom from religion, in: Crisis Magazine, 2025, 4. Juli [Artikel] - https://crisismagazine.com/opinion/doing-politics-without-god
- "“Everything will come before His truth and be revealed,” Romano Guardini reminds us in The Virtues, a profound study written in the aftermath of the destruction of Nazi Germany, whose very rejection of divine and transcendent truth had left it in ruins. “Everything will come under His justice and receive His final verdict.” Justice is not determined by the powerful, nor by the passions, but by truth itself, which is but another name for God. And by so many acts of submission to the truth, we grow in virtue—the habit of which extends, says Guardini, “through the whole of existence, as a harmony which gathers it into a unity.” Thus does it rise to God, even as it radiates out from God."
- [2025-091] Simon Robert Müller: Das Verhältnis von Welt und Mensch bei Guardini und Heidegger als Grundlage einer Zeitkritik, 2025 [Monographie] - [noch nicht online], aber https://www.lesejury.de/simon-robert-mueller/buecher/das-verhaeltnis-von-welt-und-mensch/9783689110451
- [2025-092] [Englisch] John Nepil: To Heights and unto Depths: Letters from the Colorado Trail, 2025 [Monographie] - https://books.google.de/books?id=0sRIEQAAQBAJ; zu Romano Guardini über 27 Treffer
- [2025-093] [Portugiesisch] Talis Pagot/Rafael Martins Fernandes: Antropologia e cosmovisão católica em Papa Francisco à luz das reflexões de Romano Guardini e Gaudium et spes, in: Revista de cultura teológica, 35, 2025, 110, S. 74-93 [Artikel] - https://revistas.pucsp.br/index.php/culturateo/article/view/69715/47792
- [2025-094] Christoph Raedel: Evangelisch bleiben: Verantwortlich leben in einer zerklüfteten Gesellschaft, 2025 [Monographie] - https://books.google.de/books?id=Ed5rEQAAQBAJ; zu Romano Guardini S. 82, 103, 118, 270
- [2025-095] [Englisch] Monja Reinhart: "Ex Tenebris in Lucem": Piety and Mathematics in Heinrich Scholz, in: NTT Journal for Theology and the Study of Religion, 79, 2025, 2 (Juni 2025), S. 198-217 [Artikel] - [noch nicht online]; zu Romano Guardini S. ???
- Abstract: "Heinrich Scholz (1884–1956) remains an enigma within the academic community, resisting clear categorisation within a specific discipline. One might inquire whether he is a theologian, a philosopher, or a logician. In fact, he is all at once. This can only be explained from the perspective of his intellectual biography. The objective of the present article is to provide further insight into Scholz’s intellectual development by analysing previously unpublished material. This study is based on the hitherto unknown correspondence of 180 letters between Heinrich Scholz and Fanny Kempner, a Jewish banker’s wife from Berlin."
- [2025-096] [Englisch] Jeremy Sampson: Chapter 6: Breaking The Rules - Wittgenstein´s Metagame, in ders. (Hrsg.): Philosophy’s Gambit: Play and Being Played, 2025, S. 105 ff. [Artikel] - https://books.google.de/books?id=O_IkEQAAQBAJ&pg=PA109; zu Romano Guardini S. 109 f.
- [2025-097] [Englisch] Gleaves Whitney: Decadence and Its Critics, in: The imaginative conservative, 2025, 20. Juli [Artikel] - https://theimaginativeconservative.org/2025/07/decadence-critics-gleaves-whitney.html; zu Romano Guardini:
- "In the twentieth century the German theologian Romano Guardini also speaks of the need to redeem the West’s modern mistakes. In The End of the Modern World, Guardini writes: "My [book] has nothing in common…with that cheap disposition which revels always in prophesying collapse or destruction. It has nothing in common with that desire which would surrender the valid achievements of modern man. Nor is my [book] linked with a longing for a romantically envisioned Middle Ages or with an advance into a glorified utopia of the future. But this [book]…will enable us both to understand and to master the meanings implicit in the new world that is upon us. That humanity was matured and deepened by its experience of the modern world cannot be denied."[8 Romano Guardini, The End of the Modern World: A Search for Orientation. Introduction by Frederick D. Wilhelmsen, trans, Joseph Theman and Herbert Burke (London, 1957), 69.]"
Zu: Der Gegensatz (1925)
Bearbeiten
Rezensionen zu: Die Tugenden (1963)
Bearbeiten
Rezensionen zu: La Rosa Bianca (1994)
Bearbeiten
Bearbeiten
Literatur, Sprache und Kunst
- [2025-096] [Englisch] Ann Hartle: Flannery O'Connor and Blaise Pascal: Recovering the Incarnation for the Modern Mind, 2025 [Monographie] - https://books.google.de/books?id=1IBmEQAAQBAJ; zu Romano Guardini S. 9, 37-40, 62-67, 104 f., 110, 130, 137, 141 f., 148, 152, 155, 157-161, 173 f., 178
- [2025-097] [Englisch] Johanna Merz: Artificial Creativity and Human Fragility, in: Modern Theology, 2025, 31. Oktober [Artikel] - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/moth.70048?af=R (mehrere Verweise auf und Zitate aus: Guardini, Über das Wesen des Kunstwerks)
Zu: Dostojewskij (1931)/Rezensionen zu: Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk (1939)
Bearbeiten
Zu: Dante (1931)
- [2025-098] Imre von Gaál: Maria und die Letzten Dinge in Dantes "Divina Commedia": Inferno, Purgatorio und Paradiso, in: Manfred Hauke (Hrsg.): Maria und die Eschatologie, 2025, S. 124-140 [Artikel] - https://books.google.de/books?id=T9cHEQAAQBAJ&pg=PA129; zu Romano Guardini:
- S. 129: "Mehr als zwanzig Jahre lang hielt der Priester und Theologe Romano Guardini (1885-1968) Lehrveranstaltungen zu Dantes Göttlicher Komödie. "In Dantes Werk gelangt die Wesensform des Mittelalters zu ihrer vollkommenen Erscheinung. Wohl nirgends sonst werden Lebensgefühl, Gestaltwille und Sinnerfahrung jener großen Epoche so groß entfaltet, so zart differenziert und mit so glühender Leidenschaft gegen die auflösenden Mächte verteidigt wie hier"[13 Romano Guardini, Dantes Göttliche Komödie. Ihre philosophischen und religiösen Grundgedanken. Vorlesungen, aus dem Nachlass herausgegeben von Hans Mercker unter Mitarbeit von Martin Marschall (Romano Guardini, Werke), Mainz/Paderborn 1998, 5], schreibt er. Kenntnisreich urteilt Guardini: Dass Dante "aus einem so starken Bewusstsein von der Größe und Verantwortung seiner Persönlichkeit heraus die mittelalterliche Welt und ihre Ordnungen anschaut, gibt seinem Auge erst das volle Wissen um ihr Wesen, seinem Herzen das Gefühl der Gefahr für ihre bedrohten Werte, seinem Wort die Kraft der genauen, für immer gültigen Gestaltung des überreif Gewordenen"[14 Ebd., 38.]. Im Zuge dessen gewinnt er, so fährt Guardini fort, "die Haltung eines aristokratischen Konservatismus [...] und [...] das Bewusstsein einer abendländischen Geschichtsgemeinschaft"[15 Ebd., 26.]. Die erste philosophische Synthese gelingt Dante im unvollendeten Convivio. Mit dem avignonischen Exil der Päpste (1309-1379) nimmt Dante im französischen König Philipp IV. dem Schönen (1268-1314) den Zerstörer der gottgewollten mittelalterlichen Ordnung wahr. Das Geschlecht der in seiner Vaterstadt Florenz sich frühkapitalistisch gerierenden nouveau riche Medici empfindet Dante "als niedrig gesinnt, plebejisch und zuchtlos"[16 Ebd., 9 f.]. In ihrem Beharren auf kleinliche Partikularinteressen ist diese Herrscherfamilie für ihn ein Feind der christlichen, abendländischen Einheit."
Bearbeiten
Bearbeiten
Sammelbände
Noch keine Einträge
Bearbeiten
Videos
Videos in deutscher Sprache
- Audio-Interview in Radio Horeb mit Prof. Michael Wladika, ITI Trumau, über den ersten Band der Guardini-Studien: Der Mensch - "ein Entwurf auf etwas Ungeheures hin", 21. August 2025 - https://www.horeb.org/xyz/podcast/talk/20250821tm.mp3
- Katholische Akademie Berlin: Ästhetische Bildung und liturgischer Aufbruch: Kunst und Reform bei Romano Guardini, hochgeladen am 24. Juni 2025, Podiumsgespräch zum Thema "Liturgie/Wahrheit und Schönheit und deren Verortung in Guardinis Werk" mit Isabella Bruckner und Andreas Bieringer vom 18. März 2025, 19.00 Uhr - online als Audio unter: https://www.youtube.com/watch?v=DFc1nkL6-9M
- Katholische Akademie in Berlin: Vortrag von Georg Langenhorst: Weltbetrachtungen – Romano Guardini und Hans Urs von Balthasar über Literatur 31. März 2025, 19 Uhr (siehe Guardini-Stiftung - Veranstaltung; nachgeholter Termin vom 24.09.2024) - online als Audio unter: https://www.youtube.com/watch?v=OCHxot-1ok8
- Audio-Podcast von Thomas Härry und Fabienne Härry: Seitenwechsel - sowas liest du?: Nicht länger vor mir selbst davonlaufen (Romano Guardini: Die Annahme meiner selbst), 17. Juli 2025 - https://www.podcast.de/episode/690589555/nicht-laenger-vor-mir-selbst-davonlaufen
- Montag, 17. Februar 2025, 19.00 Uhr, Katholische Akademie in Bayern: Guardini-Tag 2025 - Auftaktpodium "Vorschule des Betens". Bischof Gregor Maria Hanke OSB im Gespräch mit Akademiedirektor Dr. Achim Budde - https://www.youtube.com/watch?v=U1dQEDRGYZo
- Dienstag, 18. Februar 2025: 19.00 Uhr, Katholische Akademie in Bayern: Guardini-Tag 2025 - Abendvortrag "Die Sprache des Gebets an der Grenze des Sagbaren" von Dr. Christian Lehnert, Leipzig mit anschließendem Podiumsgespräch zwischen Christian Lehnert, Sandra Gold und Patrik Schwarz (Moderation) - https://www.youtube.com/watch?v=O4UrK2K_dsY
Bearbeiten
Videos in englischer Sprache
Bearbeiten
Videos in französischer Sprache
Bearbeiten
Videos in italienischer Sprache
- 7. März 2025, Fondazione di Storia Ets, Vicenza: Buchpräsidentation des neuen Buches von Giuliana Fabris: "Pietre bianche. Romano Guardini: "Che l’uomo apra alla donna la strada…"" mit Vizebürgermeisterin Isabella Sala und der Journalistin Nicoletta Martelletto - https://www.tviweb.it/romano-guardini-che-luomo-apra-alla-donna-la-strada-venerdi-7-marzo-alla-fondazione-di-storia-ets-a-vicenza/, siehe https://www.youtube.com/watch?v=1XEQwAbbCvk
- 14. März 2025, Facoltà Teologica di Torino: Teologia oggi - Bibbia e teologia: la fecondità di una relazione, mit den Relatori: Giulio Osto, Ferruccio Ceragioli, Germano Galvagno e il moderatore Alberto Nigra - https://www.youtube.com/watch?v=a5ymMOiMJmk
- 19. April 2025: Luca Peloso (Librofago-Libri&Cultura): Romano Guardini, "L'essenza del Cristianesimo" - https://www.youtube.com/watch?v=hJSAYnCaHuY
- 29. Mai 2025: Presentazione libro Pietre bianche. Romano Guardini: Che l'uomo apra alla donna la strada... mit Roberto Ciambetti, Natale Benazzi und Giuliana Fabris, 29. Mai 2025 - https://www.youtube.com/watch?v=tfAk4F9LeLk; Interview mit Natale Benazzi und Giuliana Fabris: https://www.youtube.com/watch?v=YpuaVn8QdT4
- 9. Juli 2025: Giacomo Coccolini im Angebot "Insegnare con AI": Chi era Romano Guardini? Scopri il gigante della teologia del '900 - https://www.youtube.com/watch?v=dNtk6KJ8Sgc
- 9. Oktober 2025: Romano Guardini e la Filosofia. A cura di Francesco Ghia, Università di Trento - https://www.youtube.com/watch?v=qnS-p1JXZGE
- 13. Oktober 2025: Pasquale Bua gab kürzlich ein Interview mit Giuseppe Di Leo vom Radio Radicale über den von ihm herausgegebenen Band der Opera Omnia über die ekklesiologischen Schriften Guardinis (Opera omnia, vol. XI: Ecclesiologia) - https://www.radioradicale.it/scheda/771376/intervista-a-pasquale-bua-sullopera-di-romano-guardini-ecclesiologia-morcelliana.
- 20. Oktober 2025: Cattedra Guardini 2025: Pasquale Bua: “Guardini nella svolta ecclesiologica del Novecento” - Video vom Vortrag in der Aula Magna del Polo culturale Vigilianum - über Diocesi di Trento - Servizio Comunicazione: https://www.youtube.com/watch?v=-IsYNrJxqk0
- 17. November 2025 (hochgeladen: 3. Dezember 3025): Fondamenti. Spirituali o materialisti? Massimo Borghesi e Andrea Lonardo su Romano Guardini - https://www.youtube.com/watch?v=M30FXAohsxU
Bearbeiten
Videos in niederländischer Sprache
- 4. November 2025: De Herbergiers Podcast (Herwin Horst, Jesse Reith und Stefan Ansinger OP): De Herbergiers over Heilige Symbolen (Guardini) - https://www.youtube.com/watch?v=BsKWHaIocZo
- "Wat heeft de ziel met de Godslamp te maken? En waarom slaan we plechtig een kruis? In deze aflevering verdiepen en verrijken we ons geloof door symbolen uit onze kerken en liturgie te bespreken. We doen dat aan de hand van het boekje ‘Van heilige symbolen’ van de katholieke priester, theoloog en filosoof Romano Guardini (1885-1968)."
Bearbeiten
Videos in polnischer Sprache
Bisher noch keine Einträge
Bearbeiten
Videos in portugiesischer Sprache
Bearbeiten
Videos in slowenischer Sprache
Bisher noch keine Einträge
Bearbeiten
Videos in spanischer Sprache
Bearbeiten
Videos in tschechischer Sprache
Bearbeiten
Bearbeiten
|